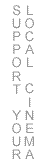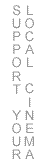Bilder auch einen hohen Informationswert, bezeugen sie doch die spektakulären Veränderungen in der Welt von Film und Kino über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten und in drei verschiedenen Ländern – Frankreich, Deutschland und USA. Von der handbetriebenen Kurbelkamera in schlichtem Holzgehäuse bis zur gewaltigen Mitchell , die elektrisch betrieben und in eine schallisolierende Hülle gepackt wurde, vergingen nur 30 Jahre. Für die Filmgeschichte aber war diese Zeitspanne wie ein Sprung von der Steinzeit in die Moderne. Auch die Beleuchtung entwickelte sich rasant. Ein Vergleich der trompe-l’oeil-Kulissen aus der Frühzeit des Films mit den verschwenderischen Hollywood-Sets der 1920er und 30er Jahre wirkt geradezu unfassbar, und mit dem Einzug der „Sprechfilme“ im Jahr 1927 erlebten Film und Kino eine weitere radikale Veränderung. Nichts blieb davon verschont, weder Technik noch Ästhetik, und schon gar nicht die Ökonomie.
Die in dieser Ausstellung gezeigten Fotografien sind auch wertvolle Zeugnisse für die Hierarchien auf einem Filmset: wie die Techniker miteinander umgehen und wie Regisseure ihre Teams dirigieren. Manche der Fotos wurden von großen Meistern gemacht: Roger Forster, Raymond Voinquel, Walter Limot, Roger Corbeau oder Sam Lévin in Frankreich; Horst von Harbou, Rudolf Brix, Curt Oertel in Deutschland; George Hurrell, Ruth Harriet Louise, Clarence Sinclair Bull und Laszlo Willinger in den USA. Andere Fotografen werden wohl für immer anonym bleiben.
Das Metier des Standfotografen gab es zwar bereits zu Beginn der Filmgeschichte, seine wirkliche Bestimmung aber fand es erst in den 1910er Jahren, einer Zeit, in der die „Filmverlage“ auch Plakate und Kataloge druckten und das Star- System, unterstützt durch eine spezialisierte Presse, aufblühte.
Die in dieser Ausstellung gezeigten Fotografien sind auch wertvolle Zeugnisse für die Hierarchien auf einem Filmset: wie die Techniker miteinander umgehen und wie Regisseure ihre Teams dirigieren. Manche der Fotos wurden von großen Meistern gemacht: Roger Forster, Raymond Voinquel, Walter Limot, Roger Corbeau oder Sam Lévin in Frankreich; Horst von Harbou, Rudolf Brix, Curt Oertel in Deutschland; George Hurrell, Ruth Harriet Louise, Clarence Sinclair Bull und Laszlo Willinger in den USA. Andere Fotografen werden wohl für immer anonym bleiben.
Das Metier des Standfotografen gab es zwar bereits zu Beginn der Filmgeschichte, seine wirkliche Bestimmung aber fand es erst in den 1910er Jahren, einer Zeit, in der die „Filmverlage“ auch Plakate und Kataloge druckten und das Star- System, unterstützt durch eine spezialisierte Presse, aufblühte. Diese Fotos führen uns direkt ins Herz der Bilderfabriken, in eine Zeit, in der die Kamera mit aufrichtiger Bewunderung als eine „intelligente Maschine“ gesehen wurde, wie der Regisseur und Theoretiker Jean Epstein es einmal ausdrückte.
 |
 |
 |
| |
|
|
| Studiobau „Guggenheim-Museum New York City“ in Babelsberg THE INTERNATIONAL Tom Tykwer, 2009 Quelle: Studio Babelsberg AG |
|
| Regisseur Fritz Lang am Megaphon bei der Aufnahme einer Massenszene für METROPOLIS (Deutschland 1927, Regie: Fritz Lang) in den Ufa-Ateliers Neubabelsberg. Produktion: Ufa Quelle: Collection Cinémathèque française, Paris / dépôt Fritz Lang © Horst von Harbou - Deutsche Kinemathek |
|
| Studioaufnahmen für eine Tanzszene in BROADWAY TO HOLLYWOOD (USA 1933, Regie: Willard Mack). Produktion: MGM Quelle: Collection Isabelle Champion, Paris |
|
Studios
Die ersten Filmateliers, so auch jenes von Georges Méliès in Montreuil, waren rundum verglast. Mit der Ankunft des Tonfilms wurden die schlecht isolierten französischen Studios zugunsten elektrifizierter und schallisolierter Bunker aufgegeben. Die Deutsche Bioscop errichtete ihr Babelsberger Glashaus im Jahr 1912, in dem ab Februar gedreht wurde. 1922 ging das Atelier in den Besitz der Decla-Bioscop über, die bereits Ende 1921 von der Ufa übernommen worden war. Während der Produktion von Fritz Langs METROPOLIS ließ die Ufa 1926 ein neues Filmatelier mit etwa 8.000 m² Fläche errichten. In den USA befanden sich die ersten Ateliers auf Hausdächern in Städten an der Ostküste. Auf diese Weise versprach man sich in New York, Chicago oder Philadelphia, am meisten vom Sonnenlicht zu profitieren. Die ersten amerikanischen Glashäuser finanzierten der Erfinder und Unternehmer Thomas Edison und der in Breslau geborene Geschäftsmann und Kinopionier Siegmund Lubin.
Erst als die Handelskammer von Los Angeles 350 Sonnentage pro Jahr anpries, siedelte sich im Jahr 1909 der Produzent William Nicholas Selig im kalifornischen Edendale, nordwestlich von Los Angeles gelegen, an und legte damit den Grundstein für die amerikanische Filmindustrie. Andere Firmen folgten und zogen bald weiter nach Hollywood, ein Tal, das bis dahin vor allem für seine Zitrusfrüchte und Weinberge bekannt war. Universal, Eclair und Lasky breiteten sich am Sunset Boulevard aus. Eine neue Ära begann.
Set-Fotografie
Sobald der Standfotograf die Dreharbeiten in den Blick nimmt, offenbart sich Magie: der Regisseur in Aktion, der Kameramann am Sucher, die in Licht getauchten Schauspieler unter den aufmerksamen Augen der Techniker, alles wird sichtbar. Die Künstlichkeit der Studio-Kulissen tritt hervor, die Geheimnisse der Traumfabrik werden gelüftet, und zugleich wird der Standfotograf, in vollständigem Einvernehmen mit Team und Regisseur, zum deus ex machina, der den Zauber mit Autorität und einem Markenzeichen versieht. Diese Fotos der 1920er und 30er Jahre stellen einen nie wieder erreichten ästhetischen Höhepunkt dar.
Allerdings ist heute kaum einer ihrer Schöpfer bekannt. Für Frankreich kann man Roger Corbeau, Roger Forster, Raymond Voinquel, Walter Limot und Sam Lévin nennen. In Deutschland ist es vor allem Horst von Harbou, der untrennbar mit den Filmen von Fritz Lang verbunden ist. Und in den USA sind große Namen unter anderen George Hurrell, Ruth Harriet Louise, Clarence Sinclair Bull und Laszlo Willinger, die als Angestellte der großen Studios Fotos am Fließband produzierten und oft für eine lange Zeit deren Produktionen begleiteten. Ihre publizierten Fotos sind deshalb nur selten namentlich gezeichnet. Diese Magier des Lichts arbeiteten zumeist sprichwörtlich im Dunkeln.
 |
 |
 |
| |
|
|
| Regisseur Fritz Lang und Hauptdarstellerin Brigitte Helm am Set von METROPOLIS (Deutschland 1927, Regie: Fritz Lang) Quelle : Collection Cinémathèque française, Paris Produktion : Ufa © Horst von Harbou - Deutsche Kinemathek |
|
| Stan Laurel, Oliver Hardy und der Regisseur James Parrott bei den Dreharbeiten zu COUNTY HOSPITAL (USA 1932, Regie: James Parrott) in Culver City. Produktion: Hal Roach / MGM Quelle: Collection Isabelle Champion, Paris |
|
| Regisseur Andreas Dresen mit seinen Hauptdarstellerinnen Nadja Uhl und Inka Friedrich bei den Dreharbeiten zu SOMMER VORM BALKON (D 2005, Regie: Andreas Dresen). Produktion: Rommel Film / X-Filme © X-Filme, Berlin |
|
Berlin im Film
Berlin wird als realer Ort oder Mythos in zahlreichen deutschen und internationalen Filmproduktionen inszeniert. Das mag damit zusammenhängen, dass sich hier die deutsche Geschichte gleichsam verdichtet darstellen lässt. Ob es darum geht, Filme über die nationalsozialistische Diktatur, den Kalten Krieg, den Deutschen Terrorismus oder die politische Wende von 1989/90 zu drehen – stets lassen sich Berliner Originalschauplätze benennen, die einer Geschichte ihr Gesicht geben. Doch auch das Berlin der Gegenwart ist zu einer Chiffre, zu einem visuellen Image geworden, das spätestens seit LOLA RENNT (Tom Tykwer, 1998) auch international erfolgreich ist.
Zuweilen wird ein Ort mit hohem Wiedererkennungswert im Film bewusst als Klischee eingesetzt, manchmal erfährt ein Schauplatz auch eine große funktionelle Umwertung und ist auf der Leinwand kaum wieder zu erkennen. Berlin bietet ein breites Spektrum an Baustilen und Milieus, so dass sich hier leicht auch ausländische Schauplätze inszenieren lassen. So verwandelt sich in THE BOURNE SUPREMACY (Paul Greengrass, 2004) der Spittelmarkt in eine Moskauer Straße, und in THE GHOST WRITER (Roman Polanski, 2010) wird die Charlottenstraße ins Londoner Zentrum verlegt.
Locations und Sets
Um Orte zu finden, die den historischen Vorbildern und den produktionstechnischen Bedürfnissen gerecht werden, durchstreifen Location Scouts die Stadt. Sie fotografieren potenzielle Drehorte und berücksichtigen neben architektonischen Vorgaben vor allem dramaturgische und logistische Anforderungen. Auch treffen sie erste Absprachen über mögliche Drehzeiten und andere Konditionen. Location Scouts bedürfen einer großen filmischen Phantasie, um in Orten das zu sehen, was diese auch sein könnten, wenn sie vom Szenenbildner modifiziert und durch das Objektiv einer Filmkamera betrachtet werden.
Das filmische Bild Berlins wird jedoch nicht allein durch Drehs on location , sondern auch durch Studiobauten in Babelsberg nachhaltig geprägt. Für den Film SONNENALLEE (Leander Haußmann, 1999) wurde auf dem Babelsberger Außengelände eine große Freiluftkulisse errichtet, die so genannte „Berliner Straße“. Der Straßenzug im Originalmaßstab kam seither in zahleichen Film- und Fernsehproduktionen zum Einsatz. Auch internationale Produktionen – wie VALKYRIE (Brian Singer, 2008), DER VORLESER (Stephen Daldry, 2008) oder INGLOURIOUS BASTERDS (Quentin Tarantino, 2009) – entstanden in den Babelsberger Studios und nutzten zugleich Berliner Originalkulissen.
Wann Wo
Am Set Paris - Babelsberg - Hollywood, 1910 bis 1939 Berlin - Babelsberg, heute
15. Dezember 2011 bis 29. April 2012
Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen Filmhaus am Potsdamer Platz, 1. OG
Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin-Tiergarten
S-/U-Bahn Potsdamer Platz, Bus M48, M85, 200 Varian-Fry-Straße
Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr
Erwachsene 4 € | ermäßigt 3 € | Schüler 2 € Sonderausstellung inkl. Ständige Ausstellungen Film und Fernsehen: Erwachsene 6 € | ermäßigt 4,50 € | Schüler 2 € Gruppentickets ab 10 Personen 4,50 € pP Familienticket 2 Erw. + Kinder 12 € Familienticket 1 Erw. + Kinder 6 €
 MAPS
MAPS